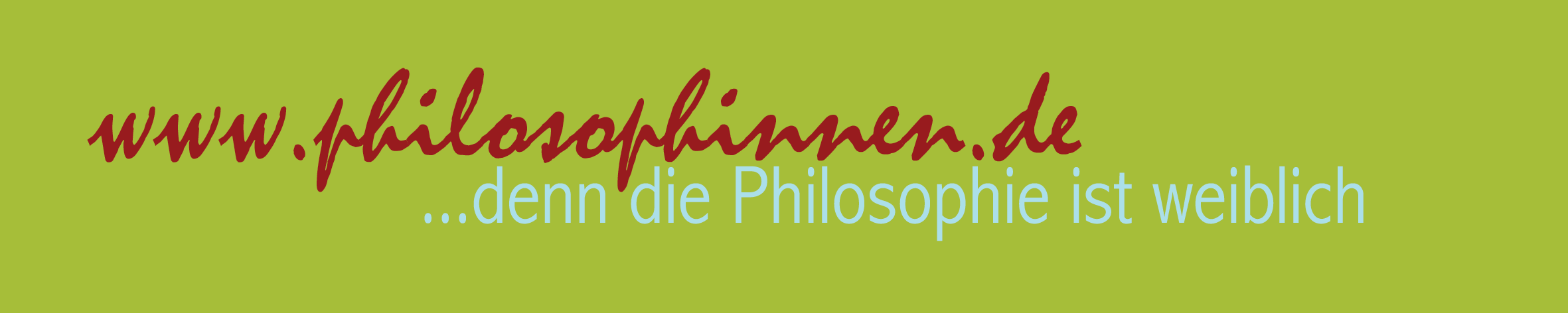
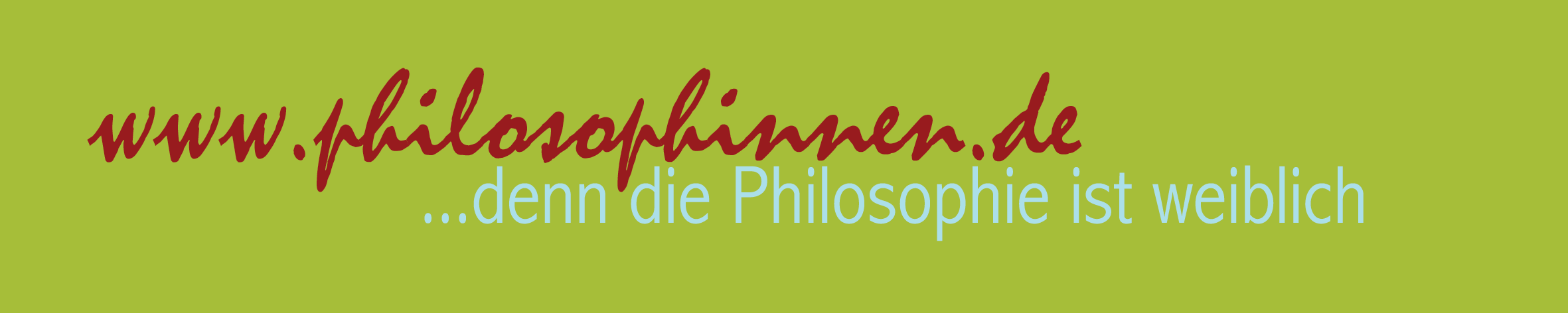
|
Geschichte
|
Fortsetzung Olympe de Gouges:
Auszug aus: Die Welt der Philosophin Band 3
Olympe de Gouges wurde unter dem Namen Marie Gouze am 7. Mai 1748 in Montauban (Languedoc) geboren, einem Städtchen, das nördlich von Toulouse, zwischen dem Quercy und der Gascogne liegt. Ihre Mutter, Anne-Olympe Mouisset (*1714, †1784), war die Tochter eines wohlhabenden Tuchscherers und mit dem Metzger Pierre Gouze verheiratet. Olympe wurde als drittes von vier Kindern geboren und von Pierre Gouze als seine Tochter anerkannt; Olympes richtiger Vater war er allerdings nicht. Anne-Olympe, die seit ihrer Kindheit mit dem Sohn der angesehensten Familie am Ort befreundet war, eine Verbindung, die von seiner Familie nicht akzeptiert wurde, unterhielt auch während ihrer Ehe intime Beziehungen zu ihm. Zur Zeit von Olympes Geburt war ihr „natürlicher“ Vater ein bedeutender Mann (er hatte zusammen mit Voltaire in Paris studiert), hatte als Dichter und konservativer Politiker einen Namen und war amtierender Präsident des Cour des Aides, der neben dem königlichen Intendanten und dem Bischof Montauban regierte. Jean-Jacques Lefranc de Caix des Lisle et de Pompignan (*1709, †1784) war bekanntermaßen der Geliebte ihrer Mutter und hatte angeblich Anne-Olympes Mann ans andere Ende Frankreichs versetzen lassen, um ungestörter seine Liaison mit Olympes Mutter zu pflegen. Zwei Jahre nach Olympe de Gouges’ Geburt, 1750, starb Pierre Gouze unerwartet, und Lefranc bot ihrer Mutter an, die Erziehung der Tochter zu übernehmen. Einigen Quellen zufolge lehnte Anne-Olympe sein Angebot ab, um die Tochter nicht zu verlieren. Tatsache ist, daß Lefranc Olympe nie gesetzlich anerkannt hat, weder für ihren Unterricht noch für eine ausreichende Mitgift sorgte. So wuchs Olympe in einfachen Verhältnissen auf, obwohl die Familie nicht unvermögend war. Ihre Ausbildung war eher bruchstückhaft, in der Klosterschule der Ursulinen lernte sie halbwegs Lesen und Schreiben, was bei der hohen Zahl von Analphabetinnen schon ein Privileg war. Später stellte de Gouges immer wieder fest, wie sehr ihr eine solide Ausbildung fehlte. Über die Jahre, die Olympe in der Kleinstadt verlebte, ist wenig bekannt, da sie keine biographischen Texte hinterlassen hat. Allerdings hat sie nach eigenen Aussagen mit ihren Memoiren der Madame Valmont über die Undankbarkeit und die Grausamkeiten der Familie der Flaucourt gegenüber der Ihrigen „einen Roman mit dem Porträt meines Charakters“ veröffentlicht. Der Roman wurde zwischen 1783 und 84 geschrieben und erschien 1786 als Broschüre. Aufgebaut ist er als Briefwechsel und hat die Problematik zum Inhalt, als Kind und junge Frau vom ‘natürlichen’ Vater nicht anerkannt zu werden. 1765, mit 17 Jahren, wurde Olympe mit einem Mann verheiratet, den sie weder liebte noch schätzte, dem Koch Louis-Yves Aubry. Ein Jahr später wurde sie schwanger und brachte ihren einzigen überlebenden Sohn, Pierre, zur Welt. Bereits im Laufe des ersten Ehejahres starb ihr Mann, und die 18-jährige Witwe hielt nun nichts mehr in der heimatlichen Kleinstadt. 1770 verließ sie das hugenottische Montauban und ging mit dem königlichen Unternehmer für Militärtransporte, Jacques Biétrix de Rozière, nach Paris, wo sie zuerst bei ihrer Schwester Jeanne Reynard lebte. Mit Rozière verband sie eine Liebesaffäre und er eröffnete ihr den Zugang zur besseren Gesellschaft. Er unterstützte sie finanziell und ermöglichte ihr einen aufwendigen Lebensstil, so daß sie schnell zu einigem Wohlstand kam. Später finanzierte er, wenn ihr eigenes Vermögen nicht ausreichte, die Publikation ihrer politischen Pamphlete und ihrer literarischen Werke. Marie Gouze, verwitwete Aubry, nannte sich nun Marie-Olympe de Gouges, später nur noch Olympe de Gouges. In ihrer Wohnung eröffnete sie einen kleinen Salon, wo sie ein intellektuelles Klientel versammelte. Paris war zu de Gouges’ Zeiten geprägt von der Dekadenz des untergehenden Ancien Régime. Die Verelendung des Volkes stand im krassen Gegensatz zur Übersättigung der Aristokratie. De Gouges’ mondänes Leben dauerte etwa 10–12 Jahre, und obwohl sie von Männern umschwärmt wurde und wegen ihrer Natürlichkeit beliebt war, war sie fest entschlossen, nicht mehr zu heiraten. Zwischen 1770 und 74 brachte sie noch ein Kind, ein Mädchen zur Welt, das jung starb. Während dieser Zeit begann de Gouges sich von der Salondame zur ‘femme de lettre’ zu entwickeln. Sie las, was gerade diskutiert wurde, z.B. Rousseau, litt aber immer unter ihrem lückenhaften Wissen. Die Forschung ist sich bis heute uneins darüber, ob sie überhaupt richtig schreiben konnte, zumal sie ihre Texte nicht handschriftlich verfaßte, sondern einem Sekretär diktierte (eine damals sehr übliche Form des Schreibens). Probleme mit dem Französischen hatte de Gouges sicherlich, denn ihre Muttersprache war das Langedocien, das als eigenständige Sprache gilt. Anfangs schrieb de Gouges vor allem im Dialogstil, mit dem sie die in den Salons praktizierte Gesprächsführung wiedergab. 1784 erschien ihr Roman Madame Valmont, später verfaßte sie vor allem Theaterstücke, die sie bei der Comédie Française einreichte. 1784 legte sie Die Liebschaften des Cherubin und im Anschluß daran Die unerwartete Hochzeit Cherubins vor. Da die Comédie selbst über die Aufführungen entscheiden konnte, sich aber auch dem Willen der Mächtigen beugen mußte, weigerte sie sich, diese zu spielen. De Gouges, die ständig Schwierigkeiten mit den SchauspielerInnen der Comédie hatte, führte diese aber nicht nur auf ihren politischen Inhalt, sondern auf eine besonders ungerechte Behandlung ihrer Person und auf die Tatsache zurück, daß sie eine Frau war. Während dieser Zeit lernte sie wahrscheinlich den Bühnenautor Louis Sébastian de Mercier kennen, der ebenfalls Probleme mit der Comédie hatte. Beide verbanden aber auch gemeinsame literarische und politische Interessen, denn de Mercier war einige Jahre Herausgeber des Journal des Dames, ehe es endgültig verboten wurde. Politisch gesehen gehörte de Mercier der Fronde-Gruppe (eine aristokratische Opposition gegen den absolutistischen König) an, die unter der Protektion der königlichen Prinzen stand. Zu ihnen gehörte auch ein Neffe Ludwigs XVI., der Herzog von Orléans, später Philippe Egalité (*1747, †1793). Er machte seine Residenz, das Palais Royal, zum Treffpunkt der Fronde-Gruppe und anderer dissidenter Kreise; wahrscheinlich hat de Mercier auch Olympe de Gouges in diese Gruppe eingeführt. Ebenfalls 1784 reichte de Gouges noch ein weiteres Drama bei der Comédie ein mit dem Titel, Zamore und Mirza oder der glückliche Schiffbruch. Damit erregte sie besonderen Anstoß, da sie hier die Forderung nach Gleichheit der Rassen aufstellt. Das Stück polemisiert gegen das Privilegienwesen des Ancien Régime und richtet sich gegen Rassismus und Kolonialismus; De Gouges spricht sich darin sehr früh gegen das Unrecht der Rassenunterdrückung aus, ein Thema, das für die Kolonialmacht Frankreich nicht zur Debatte stand. Außerdem machte sie auch noch auf die Frauenfeindlichkeit ihrer Zeit aufmerksam, ein gänzlich unpopuläres Thema. Erst 1789 wurde das Stück unter dem Titel Die Sklaverei der Neger aufgeführt und löste einen Theaterskandal aus. Wohlhabende Kolonialisten, die einen Aufstand in den Kolonien fürchteten und Angst um ihre Pfründe hatten, machten ihren Einfluß geltend, und das Stück wurde rasch wieder abgesetzt. Der Grund für de Gouges’ intensive Beschäftigung mit dem Schicksal der schwarzen Sklaven war sicherlich auch die Parallele zur Situation der Frauen, die sie schnell herstellte. Die politische Gleichstellung der Frau und die allgemeine soziale Gerechtigkeit waren in den letzten acht Jahren ihre wichtigsten Themen. Deshalb unterstützte sie die beginnenden revolutionären Strömungen und Vereine, lehnte allerdings die von den Revolutionären ausgeübte Gewalt strikt ab. De Gouges machte sich, wie auch andere Zeitgenossinnen, die Revolution zunutze, um sich für die Rechte der Frauen stark zu machen. Da die Frauen in dieser Bewegung sehr aktiv waren, bildeten sich auch rasch zahlreiche Frauenvereinigungen wie die Revolutionären Republikanerinnen. Allerdings beuteten die Männer dieses Engagement der Frauen letztlich nur für ihre Zwecke aus, denn sie verboten die Vereine wieder, nachdem sich die Nationalversammlung als Regierungsmacht durchgesetzt hatte. Ihr erstes politisches Pamphlet mit dem Titel Brief an das Volk oder Projekt einer patriotischen Kasse veröffentlichte de Gouges am 6. November 1788 im Journal Général de France. Darin schlägt sie eine Reform der Staatskasse und die Einrichtung einer freiwilligen patriotischen Kasse vor, die arme Familien unterstützen sollte. Mit dieser Armenkasse wollte de Gouges Ausschreitungen bei der Revolution verhindern, denn sie ahnte bereits zu diesem Zeitpunkt die drohenden Auseinandersetzungen. Zum gleichen Thema erschienen 1788 ihre Patriotischen Bemerkungen, in denen de Gouges ein vollständiges soziales Programm entwarf; sie wendet sich gegen die Dekadenz des ausgehenden Ancien Régime und macht den Vorschlag, Armen- und Waisenhäuser und Häuser für Mütter mit unehelichen Kindern einzurichten, in denen diese ihren Lebensunterhalt verdienen können; zur Finanzierung forderte sie eine Luxussteuer auf die Zahl der Dienstboten und Kutschen zu erheben. 1789 war ein ausgesprochen produktives Jahr für de Gouges; sie schrieb zahlreiche Broschüren, die sie in Auflagen von ein- oder zweitausend Exemplaren in Paris und Versailles verteilte, außerdem noch weitere Druckschriften, Pamphlete und Eingaben. Sie verfaßte Titel wie Der Ruf der Weisen, von einer Frau und Um das Vaterland zu retten. Ihr Thema waren immer häufiger die Rechte der Frauen, die sich auch mit dem Fortschreiten der Revolution nicht änderten. Bald stellte de Gouges fest, daß die Revolution keine des Volkes als Gesamtheit, sondern nur eine des männlichen Teiles war, denn die Gesetze von 1789 bevorzugten wieder eindeutig die Männer. Zwar waren die Frauen in den Anfängen der Revolution gern gesehene Bundesgenossinnen, doch mit der weiteren Entwicklung wurden sie immer stärker ausgeschlossen. Sie waren nur willkommen, solange sie als Unterstützung notwendig waren, stellten sie aber eigene Forderungen, wandte mann sich gegen sie. Sicherlich war es diese Erkenntnis, die de Gouges dazu bewog ihre Erklärung der Rechte der Frau zu verfassen, eine Schrift, die sie auch heute noch zu einer der wichtigsten Frauenrechtlerinnen macht. Mit ihrer Erklärung wandte sich de Gouges gleichzeitig kritisch gegen die 1789 übergebene Erklärung der Bürgerrechte, die von den Revolutionären aufgestellt wurde. Sie schloß, wie die meisten Gesetzesgrundlagen, Frauen und Nichtbürger aus. De Gouges veröffentlichte ihre Erklärung zu einem Zeitpunkt, als die Nationalversammlung ihre Beratungen beendet hatte und 1791 dem König eine neue moderate Verfassung übergab. Die von de Gouges verfaßte Erklärung der Rechte der Frau ist eine umfassendere Menschenrechtserklärung, als die 1789 von den Revolutionären vorgelegte, da sie Frauen und Nichtbürger einschließt und ihnen gleiche Rechte zuspricht. Sie fordert nicht nur, wie viele andere Frauenrechtlerinnen ihrer Zeit, gleiche Bildung und Erziehung, sondern auch die gleiche zivile Rechtsstellung für Frauen. Einer politischen Partei ist de Gouges nicht zuzuordnen, ihre Position war in erster Linie die der Frauen. Obwohl sie sich gegen die Abschaffung der Monarchie aussprach, kann man de Gouges nicht als Royalistin bezeichnen, denn sie stellte die Position des Königs durchaus in Frage. Ihr Ziel war eine Verbindung zwischen Monarchie und Demokratie, z.B. nach dem Vorbild Englands, wo Regierung und Parlament vom Volk bestimmt wurden und der König als Repräsentant der Nation fungierte. Olympe de Gouges war keine kämpfende, sondern in erster Linie eine schreibende Revolutionärin, Gewalt lehnte sie ab und deshalb versuchte sie auch den König zu schützen. Ihre Art, unverblümt ihre Meinung zu verkünden, führte schließlich auch zu ihrer Verhaftung am 20. Juli 1793; Stein des Anstoßes war die Veröffentlichung ihres Plakates Die drei Urnen. Begründet wurde die Festnahme damit, daß sie mit ihrem Text, den Artikel 1 des Gesetzes vom 29. März 1793 verletzt habe, in dem es heißt, daß jede Schrift, die zur Auflösung der Nationalversammlung aufrufe mit dem Tode bestraft würde. Dieses Gesetz, von dem unsicher ist, ob de Gouges es kannte, zeigt deutlich, wie repressiv die Revolution inzwischen gegen ihre eigenen AnhängerInnen vorging und wie überzogen man auf die sogenannte Konterrevolution reagierte. Mit ihrem Plakat Die drei Urnen forderte de Gouges eine Volksbefragung. Die BürgerInnen sollten sich zwischen den drei Urnen Monarchie, Republik und föderative Regierung entscheiden. Da dieser Aufruf die absolute Herrschaft der Nationalversammlung in Frage stellte, sah sich der oberste Ankläger Fouquier-Tinville berechtigt, de Gouges vor das Tribunal zu stellen. Ihr wurde vorgeworfen Schriften verfaßt und gedruckt zu haben, die als Angriff auf die Souveränität des Volkes betrachtet werden müssen (weil sie nach dem Willen des Volkes fragte, das sich mehrheitlich für eine republikanische Regierung ausgesprochen hat). Mit ihrem Plakat Die Drei Urnen, oder das Wohl des Vaterlandes stachele sie öffentlich zum Bürgerkrieg und zur Bewaffnung der Bürger an. Anfangs nahm de Gouges ihre Verhaftung nicht ernst und versuchte noch während der Gefangenschaft durch ein neues Plakat ihre Meinung zu verbreiten. Unter der Überschrift Olympe de Gouges vor dem Revolutionstribunal entlarvte sie Robespierre als Ehrgeizling, der die Nation opfern wolle, um eine Diktatur zu errichten. Danach war klar, daß das Tribunal die Todesstrafe verhängen würde. De Gouges wurde am 3. November 1793 auf dem Place de la Bastille hingerichtet, wenige Tage vor ihr waren Marie Antoinette und 21 Girondisten (eine gemäßigt republikanische Gruppe in der Nationalversammlung) ermordet worden.
Überlebt hat Olympe de Gouges’ Werk, das vor allem in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit in Deutschland gefunden hat. Fast 200 Jahre hat man de Gouges und ihr Werk vor allem in Frankreich totgeschwiegen, erst heute liegen einige ihrer Hauptwerke in deutscher Übersetzung vor. Herausragend ist sicherlich ihre Déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne (1791), die sie als Protest gegen die Déclaration des droits de l’Homme et de Citoyen (1789) verstand, da sich diese sowohl im Titel als auch im Inhalt nur auf Männer bezieht. Der Text Die Rechte der Frau besteht aus der Declaration und dem Contrat Social, der zwischen Frauen und Männern vereinbart werden soll. Dem Text vorangestellt ist eine Widmung an die Königin, in der sie sich, wie damals üblich, unter deren Schutz stellt. Ihre Abhandlung Die Rechte der Frau beginnt de Gouges mit dem provozierenden Satz „Mann, bist du imstande gerecht zu sein?“, mit dem sie die als natürlich geltende Vorherrschaft des Mannes grundlegend in Frage stellt und deutlich macht, daß auch die Revolutionäre, wenn es um Macht geht, in erster Linie Männer sind. Die folgende Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin, die nach de Gouges’ Vorstellung von der Nationalversammlung verabschiedet werden sollte, sichert den Frauen die Teilhabe an der politischen Macht. Sie fordert, daß Frauen, ebenso wie die Männer, Repräsentantinnen der Nation und Bestandteil der Nationalversammlung werden sollten. Um diese Gleichberechtigung gesetzlich festzulegen, hat de Gouges 16 Artikel entworfen, die gleiche Rechte und Pflichten aller Bürgerinnen und Bürger manifestieren. Zu den zentralen Rechten gehören für sie das Recht auf Freiheit, Eigentum, Sicherheit und das Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung. Eine Regierung ist nur legitim, wenn sie aus der gesamten Nation hervorgeht, also der Vereinigung von Frauen und Männern. Die von de Gouges definierten Frauenrechte schließen natürlich auch Pflichten ein; Frauen unterstehen demselben Gesetz mit den den selben Strafen, aber auch den selben Rechten. Sie können zur Armee eingezogen, aber auch in alle öffentlichen Ämter gewählt werden. Ergebnisse ihrer Überlegungen finden sich auch in ihrem Roman Le Prince Philosophe von 1792, in dem sie ihre radikal-universalen Gleichheitsvorstellungen formuliert: „Frauen sind gleich mit Männern, wenn sie es in bürgerlicher und politischer Hinsicht sind und wenn sie gleiche Erziehung genossen haben“. Bisher, so resümiert de Gouges, werde den Frauen Freiheit und Gerechtigkeit vorenthalten und sie werden an der Ausübung ihrer natürlichen Rechte gehindert. Da aber ein Gesetz der Ausdruck des allgemeinen Willens sei, müssen alle BürgerInnen an der Gesetzgebung mitwirken. Nur dann sei das Gesetz bindend für alle und dürfe auch Frauen zu Strafen für seine Übertretung verurteilen. De Gouges plädiert außerdem für freie Meinungsäußerung, privat und öffentlich für alle Frauen, worin sie eines der zentralsten Rechte sieht. Wenn die Frauen das Recht haben Steuern zu zahlen, müssen sie auch „bei der Verteilung von Stellen, Beschäftigungen, Diensten, Würden und Gewerben“ mitreden dürfen. Um die Würde der Frau zu vervollständigen fordert sie in ihrem Contrat Social das Recht, in allen Berufszweigen zu arbeiten. Auch für die speziellen Belange von Müttern sieht de Gouges einen Paragraphen in ihrer Déclaration vor, der ihnen das Recht gibt, öffentlich bekanntzugeben, wer der Vater ihres Kindes ist und von ihm Unterhaltszahlungen zu fordern; eine Klausel, die sicherlich auf ihre persönlichen Erfahrungen zurückzuführen ist. Um auch die Rechte verheirateter Frauen zu sichern, entwirft de Gouges einen Sozialvertrag zwischen Mann und Frau, der Parallelen zu dem später geschlossenen Ehevertrag von Taylor und Mill aufweist. Darin versichern sich beide Parteien der gegenseitigen Zuneigung, legen ihr Eigentum zusammen, das sie später aber getrennt vererben können. Kinder sollen den Namen von Vater und Mutter tragen. Auch die Scheidung des Paares solle ermöglicht werden, ohne die Frauen wirtschaftlich völlig zu ruinieren. Ergänzt werden müsse dieser Ehevertrag mit einem Gesetz zugunsten von Witwen und Mädchen, die betrogen wurden, und das den Mann zur Zahlung einer Entschädigung zwingen soll. Sie fordert eine Gleichstellung der freien Verbindung und der Ehe sowie der daraus entstandenen Kinder. Egal ob ehelich oder unehelich, Kinder sollten das Recht auf Mutter und Vater und deren Anerkennung haben.
Interessant ist neben der Déclaration auch der bereits erwähnte Briefroman Memoiren der Madame Valmont über die Undankbarkeit und die Grausamkeiten der Familie der Flaucourt gegenüber der Ihrigen. Er trägt autobiographische Züge und beschreibt die abenteuerliche Begegnung des jungen Marquis de Flaucort mit einer maskierten Unbekannten auf einem Ball und den darauffolgenden Briefwechsel Madame Valmonts mit ihrer Familie. Darin kommen die persönlichen Parallelen zu de Gouges besonders deutlich zum Ausdruck, denn die Briefschreiberin ist ein uneheliches Kind wie sie selbst. Thema des Romans ist das Verhältnis dieser Väter, meist hochgestellte Persönlichkeiten, zu ihren „natürlichen“ Kindern und deren Müttern, die als abgedankte Geliebte der gesetzlichen Willkür ausgeliefert sind. De Gouges kritisiert das Fehlen jeglichen gesetzlichen Schutzes dieser Frauen und Kinder. Da ihre Vaterschaft nicht festgestellt wird, können sich die Männer allen Vaterpflichten entziehen.
|
Philosophie weiter lesen
ein-FACH-verlag |
|
|
|
|