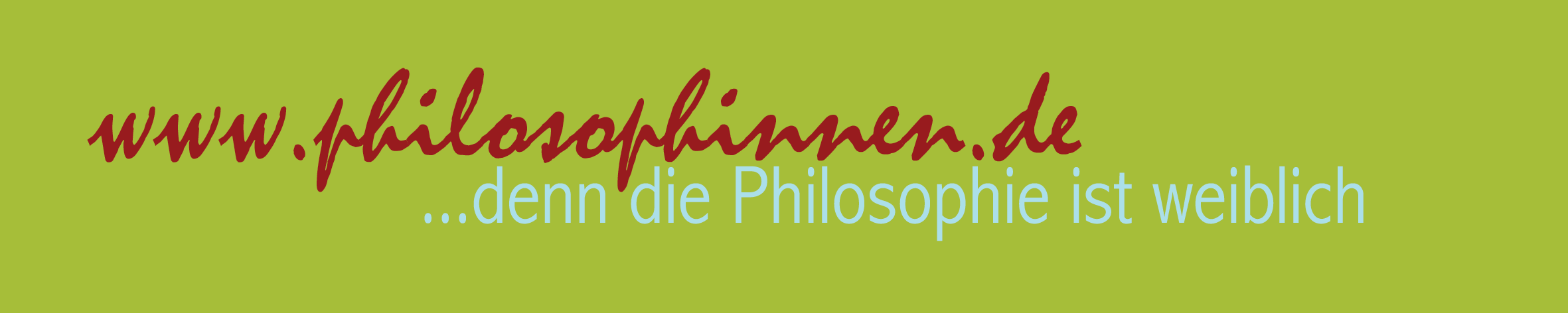
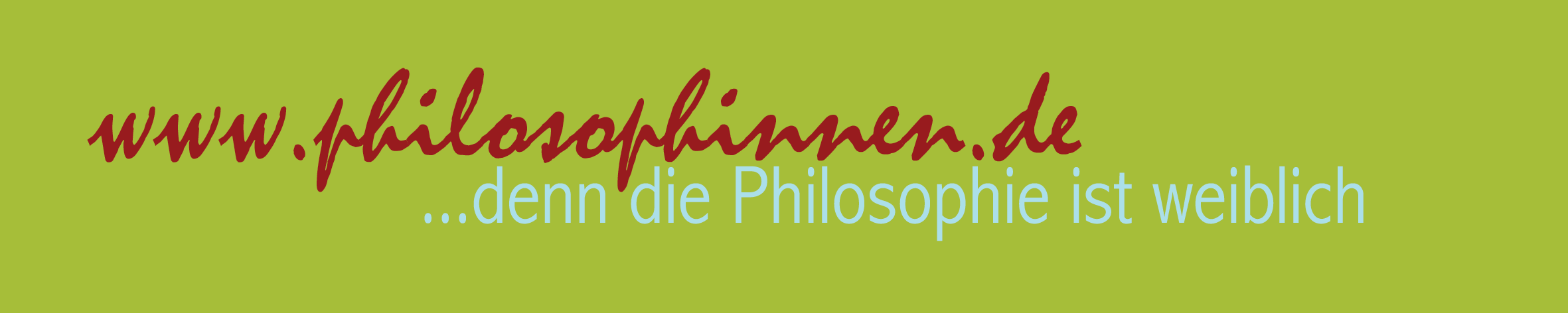
|
|
Philosophin des Monats Oktober
Sarah Kofmann
In den frühen 80er Jahren wandte Kofman ihre Aufmerksamkeit feministischen Themen zu. Beispielhaft dafür ist ihre Interpretation des Begriffs der Achtung bei Kant. Sie beschreibt Achtung als ein moralisches Gefühl, das den Frauen aufgrund ihrer Schwäche entgegengebracht wird. Die Frau selbst fordert die Achtung im Namen ihres Geschlechtes. Das Ergebnis ist eine paradoxe Situation, in der die Frau trotz ihre Schwäche zur Herrscherin wird. Sie regiert den Diener Mann, der sie dafür hasst. „Die Achtung der Frau ist immer die glorreiche, moralische Kehrseit des Frauenhasses der Männer.“ |
Philosophie weiter lesen
ein-FACH-verlag |
|
|
|
|
|
|
|